Schaukeln
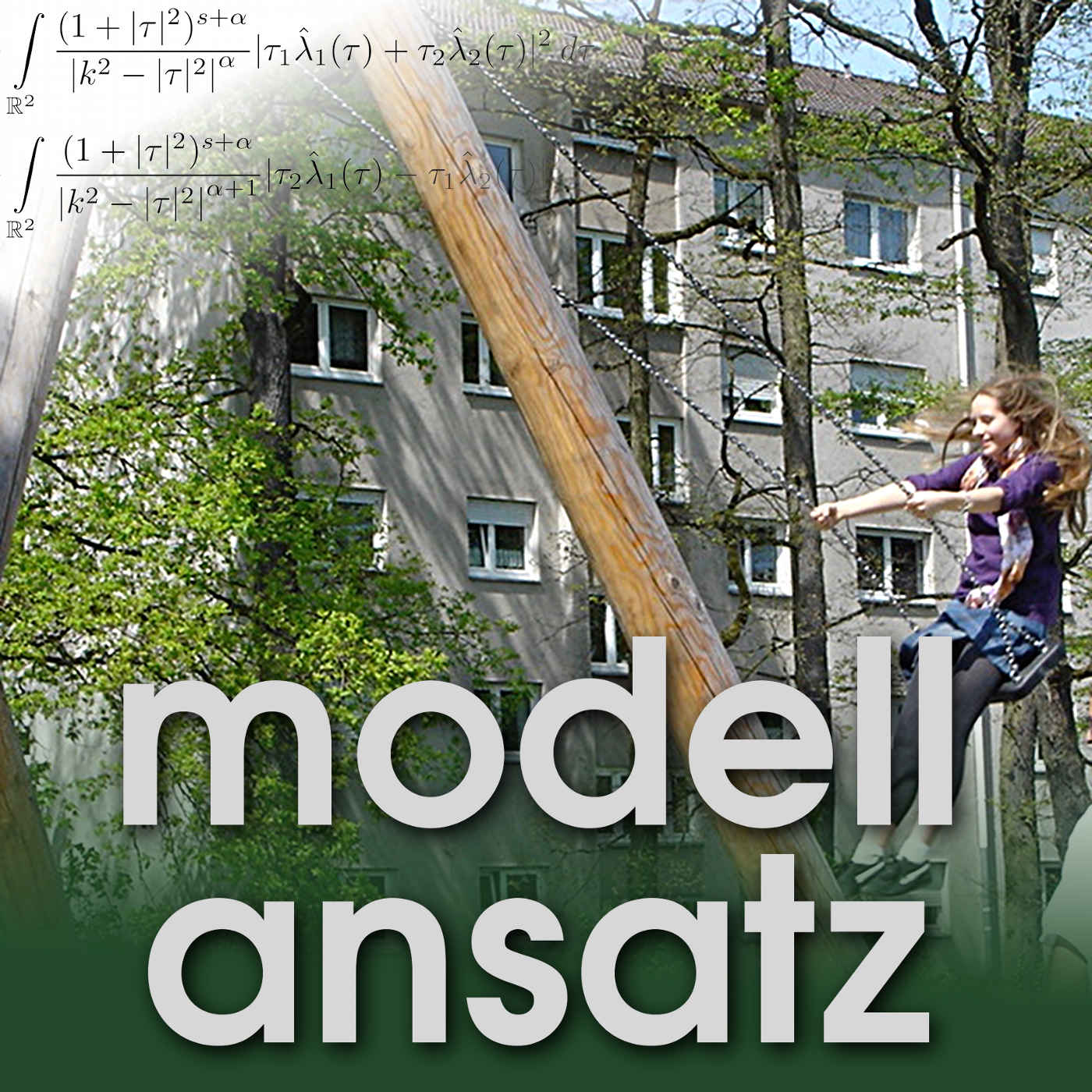
Helen hat am Karlsruher Institut f\xfcr Technologie (KIT) ihren Bachelor in Mathematik abgeschlossen. Als Bachelorarbeit hatte sie sich das Thema Schaukeln gew\xe4hlt unter der Betreuung von Gudrun Th\xe4ter. Es geht darin um Modelle, die tats\xe4chlich die Schaukel vom Spielplatz untersuchen. Die zentrale Frage, die durch die Modelle und daraus abgeleitete Simulationen beantwortet werden soll ist: Wie funktioniert das Schwung geben beim schaukeln? Eine grundlegende Idee (die Helen aus der Literatur entnommen hat) ist es, die Schaukel als Fadenpendel mit ver\xe4nderlicher Fadenl\xe4nge anzusehen. Das liegt daran, dass das Schwung geben sich vor allem durch die Ver\xe4nderung der Lage des Schwerpunkts erkl\xe4rt, die dann im Modell als ver\xe4nderliche Pendell\xe4nge eingeht. Fadenl\xe4nge als Funktion in der Zeit erwies sich als nicht praktikabel deshalb ist sie in Helens Modell nun eine Funktion von der Winkelauslenkung. Das f\xfchrt auf eine Differentialgleichung zweiter Ordnung f\xfcr die Variable der Auslenkung. Reibungsverluste der Schaukel werden auf herk\xf6mmliche Art integriert und als proportional zur Geschwindigkeit des Massepunktes angenommen. Um realistische Parameter f\xfcr Rechnungen zu gewinnen, konnten wir leider keine Experimente mit schaukelnden Kindern durchf\xfchren, sondern haben uns auf Computer-Simulation f\xfcr unterschiedliche Konstellationen verlassen und Parameter f\xfcr die realistisch erscheinenden Szenarien daraus entnommen. In der Arbeit enthalten sind nun neben dem theoretischen Modell auch unterschiedliche F\xe4lle mit verschiedenen Seill\xe4ngen und Personengr\xf6\xdfen durchgerechnet und graphisch dargestellt. Zwei Ergebnisse, die man daraus ablesen kann sind, dass k\xfcrzere Schaukeln es einem leichter machen, sich aufzuschaukeln und gro\xdfe Leute einen Vorteil haben, weil sie ihren Schwerpunkt \xfcber eine gr\xf6\xdfere Strecke verschieben k\xf6nnen. Schlie\xdflich war es entscheidend f\xfcr den Erfolg der Arbeit, sich an der richtigen Stelle Rat zu suchen.