Mikrowellen
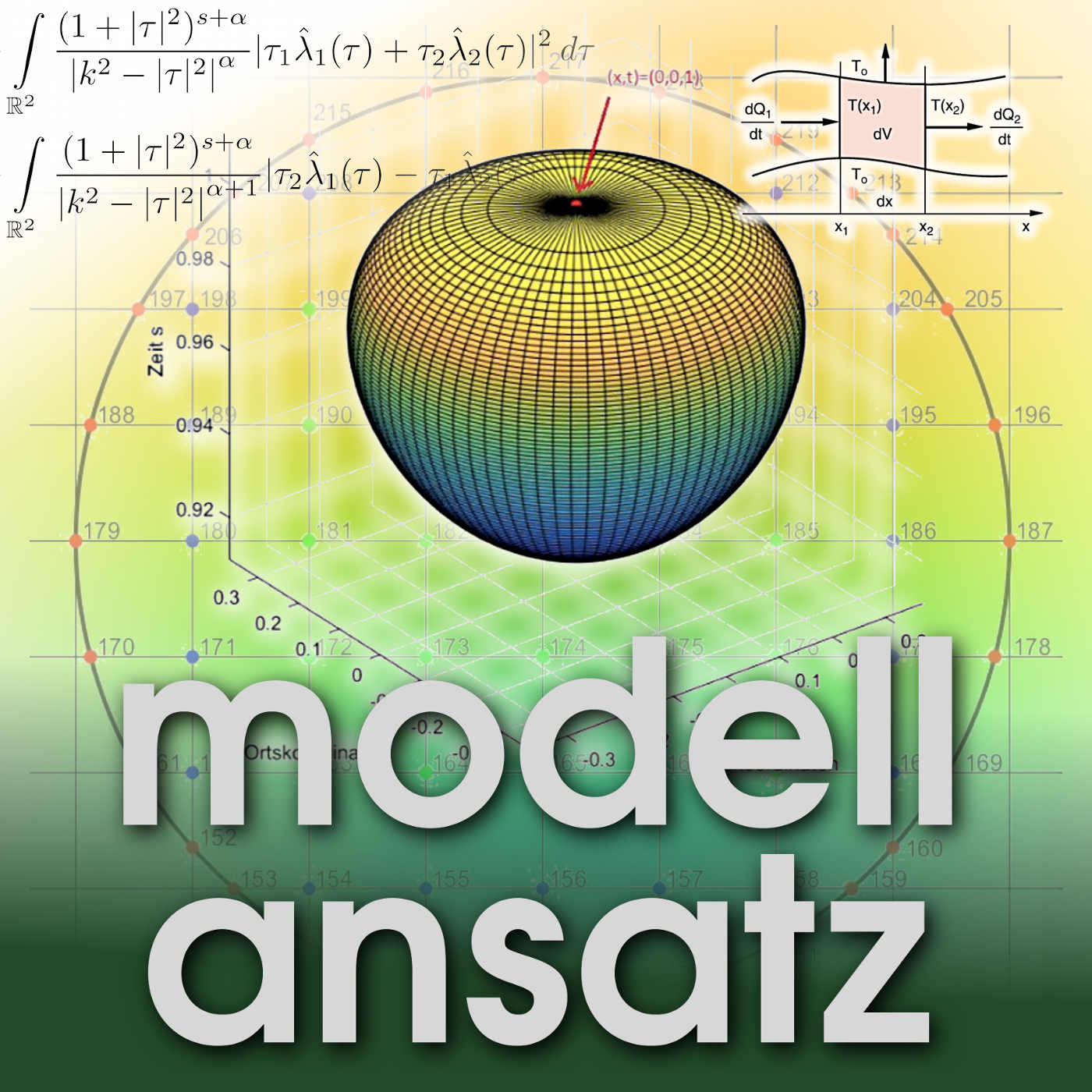
Gudrun unterh\xe4lt sich diesmal mit Johanna M\xf6dl. Johanna hat von August bis Oktober 2017 ihre Bachelorarbeit Analytische und numerische Untersuchungen zum mikrowelleninduzierten Temperaturanstieg von zylindrischen Probek\xf6rpern aus Beton geschrieben. Der Hintergrund war ein Thema aus dem Institut f\xfcr Massivbau und Baustofftechnologie (Abt. Baustoffe und Betonbau). Dort wird untersucht, wie hochenergetische Mikrowellen solche Temperaturunterschiede in (trockenen) Betonk\xf6rpern erzeugen, dass der Werkstoff an der Oberfl\xe4che zerst\xf6rt wird. Um Erfahrungswerte im Umgang mit diesem Verfahren zu erhalten, werden derzeit Laborexperimente durch das Institut f\xfcr Massivbau und Baustofftechnologie und das Institut f\xfcr Hochleistungsimpuls- und Mikrowellentechnik, beides Institute des Karlsruher Instituts f\xfcr Technologie, durchgef\xfchrt. Auf Basis der Messergebnisse wird versucht, den Vorgang durch einfache Gleichungen zu beschreiben, um vorhersagen zu k\xf6nnen, wie er sich in gr\xf6\xdferem Ma\xdfstab verh\xe4lt. Aufgrund der Komplexit\xe4t des Prozesses werden nur vereinfachende Modelle betrachtet. Da diese sich durch partielle Differentialgleichungen beschreiben lassen, sollte der Vorgang w\xe4hrend der Bachelorarbeit aus mathematischer Sicht analysiert werden. Die Ausbreitung der Mikrowellen-Energie als W\xe4rme im Baustoff wird durch die W\xe4rmeleitungsgleichung gut beschrieben. Dies ist eine in der Mathematik wohlstudierte Gleichung. Im Allgemeinen lassen sich aber analytische L\xf6sungen nur schwer oder gar nicht berechnen. Daher mussten zus\xe4tzlich numerische Verfahren gew\xe4hlt und implementiert werden, um eine Approximation der L\xf6sung zu erhalten. Johanna entschied sich f\xfcr das Finite-Differenzen-Verfahren im Raum und ein explizites Eulerverfahren in der Zeitrichtung, da beide einfach zu analysieren und zu implementieren sind. Erfreulicherweise stimmt die numerisch auf diese Weise approximierte L\xf6sung mit den experimentellen Ergebnissen in den haupts\xe4chlichen Gesichtspunkten \xfcberein. Die W\xe4rme breitet sich von der Quelle in den Beton aus und es kommt im zeitlichen Verlauf zu einer kontinuierlichen Erw\xe4rmung in den K\xf6rper hinein. Das gr\xf6\xdfte Problem und die vermutliche Ursache daf\xfcr, dass die Me\xdfdaten noch nicht ganz genau mit den Simulationen \xfcbereinstimmen ist, dass man physikalisch sinnvollere Randbedingungen br\xe4uchte. Im Moment wird - wie \xfcblich - davon ausgegangen, dass am Rand des Betonzylinders, wo nicht die Energie eintritt, der K\xf6rper Umgebungstemperatur hat. Hier br\xe4uchte man eine phyiskalische Modellierung, die das korrigiert.