Helmholtzzerlegung
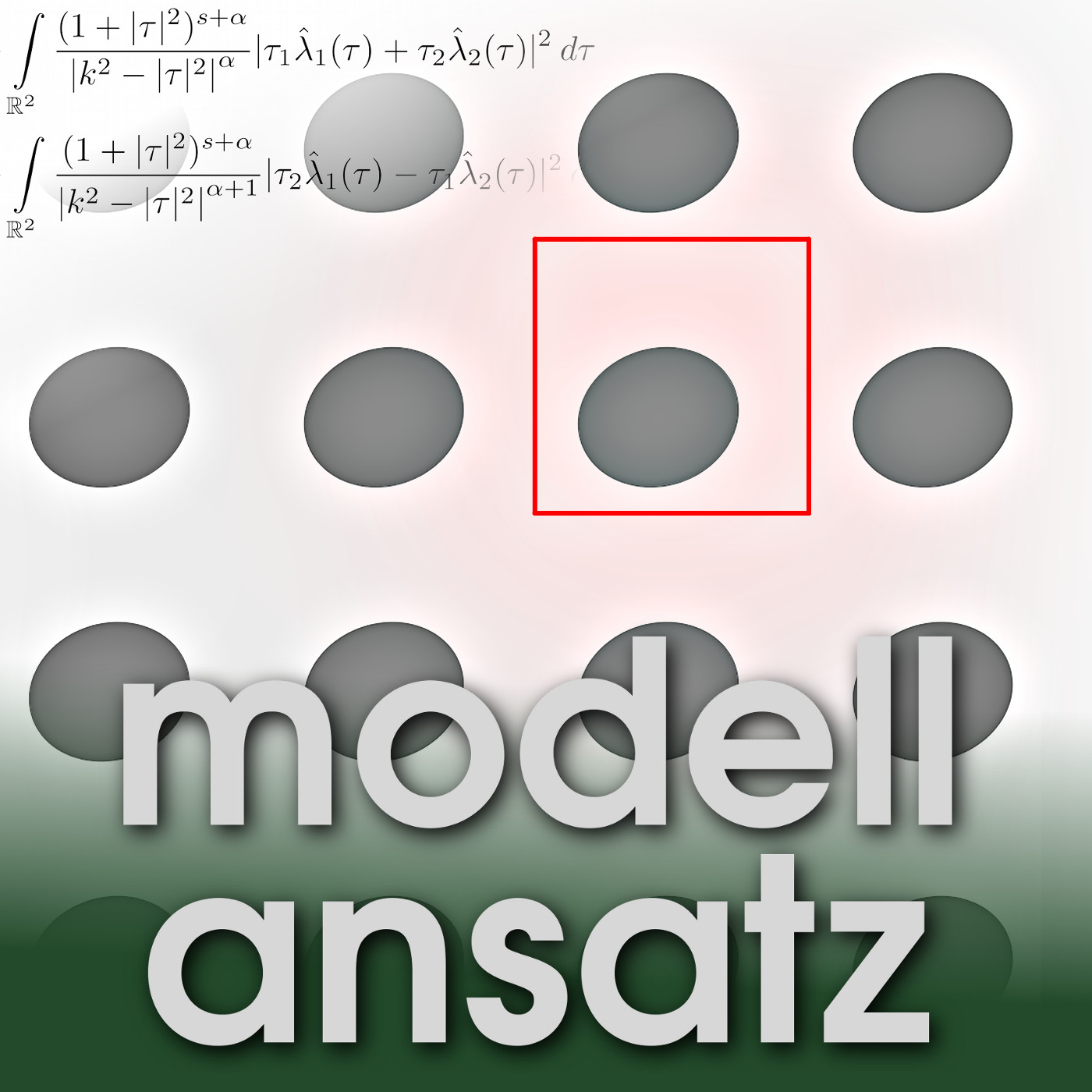
Jens Babutzka hat Anfang 2016 seine Promotion an der KIT-Fakult\xe4t f\xfcr Mathematik verteidigt. Das Gespr\xe4ch dreht sich um einen Teil seiner Forschungsarbeit - dem Nachweis der G\xfcltigkeit der sogenannten Helmholtz Zerlegung im Kontext von Gebieten mit einer sich periodisch wiederholenden Geometrie. Das l\xe4sst sich f\xfcr die Untersuchung von photonischen Kristallen ausnutzen unter der Wirkung einer Zeit-harmonischen Wellengleichung. F\xfcr die Untersuchung von partiellen Differentialgleichungen auf L\xf6sbarkeit, Eindeutigkeit der L\xf6sungen und deren Regularit\xe4t gibt es verschiedene Grundwerkzeuge. Eines ist die Helmholtz Zerlegung. Falls sie in einem Raum m\xf6glich ist, kann man jedes Vektorfeld des Raumes eindeutig aufteilen in zwei Anteile: einen Gradienten und einen zweiten Teil, der unter der Anwendung der Divergenz das Ergebnis Null hat (man nennt das auch divergenzfrei). Wann immer Objekte miteinander skalar multipliziert werden, von denen eines ein Gradient ist und das andere divergenzfrei, ist das Ergebnis Null. Anders ausgedr\xfcckt: sie stehen senkrecht aufeinander. Die Untersuchung der partiellen Differentialgleichung l\xe4sst sich dann vereinfachen, indem eine Projektion auf den Teilraum der divergenzfreien Funktionen erfolgt und erst im Anschluss die Gradienten wieder "dazu" genommen, also gesondert behandelt werden. Da die Eigenschaft divergenzfrei auch physikalisch als Quellenfreiheit eine Bedeutung hat und alle Gradienten wirbelfrei sind, ist f\xfcr verschiedene Anwendungsf\xe4lle sowohl mathematisch als auch physikalisch motivierbar, dass die Aufteilung im Rahmen der Helmholtz Zerlegung hilfreich ist. Im Kontext der Str\xf6mungsmechanik ist die Bedingung der Divergenzfreiheit gleichbedeutend mit Inkompressibilit\xe4t des flie\xdfenden Materials (dh. Volumina \xe4ndern sich nicht beim Einwirken mechanischer Kr\xe4fte). F\xfcr das Maxwell-System kann es sowohl f\xfcr das magnetische als auch f\xfcr das elektrische Feld Divergenzfreiheitsbedingungen geben. Ob die Helmholtz Zerlegung existiert, ist im Prinzip f\xfcr viele R\xe4ume interessant. Grundbausteine f\xfcr die Behandlung der partiellen Differentialgleichungen im Kontext der Funktionalanalysis sind die Lebesgue-R\xe4ume L^q(\\Omega). Eine (verallgemeinerte) Funktion ist in L^q(\\Omega), wenn das Integral (des Betrags) der q-ten Potenz der Funktion \xfcber Omega existiert. Eine Sonderrolle spielt hier der Fall q=2, weil dieser Raum ein Skalarprodukt hat. Das gibt ihm eine sehr klare Struktur. Dar\xfcber hinaus ist er zu sich selbst dual. Unter anderem f\xfchrt das dazu, dass die Helmholtz Zerlegung in L^2(\\Omega) f\xfcr beliebige Gebiete \\Omega mit gen\xfcgend glattem Rand immer existiert. Wenn q nicht 2 ist, sind Gebiete \\Omega bekannt, in denen die Helmholtz Zerlegung existiert, aber auch Gegenbeispiele. Insbesondere bei der Behandlung von nichtlinearen Problemen reicht es aber h\xe4ufig nicht, sich auf den Fall q=2 zu beschr\xe4nken, sondern die Helmholtz Zerlegung f\xfcr m\xf6glichst viele q wird eine wesentliche Voraussetzung f\xfcr die weitere Theorie. (...)