Dynamische Benetzung
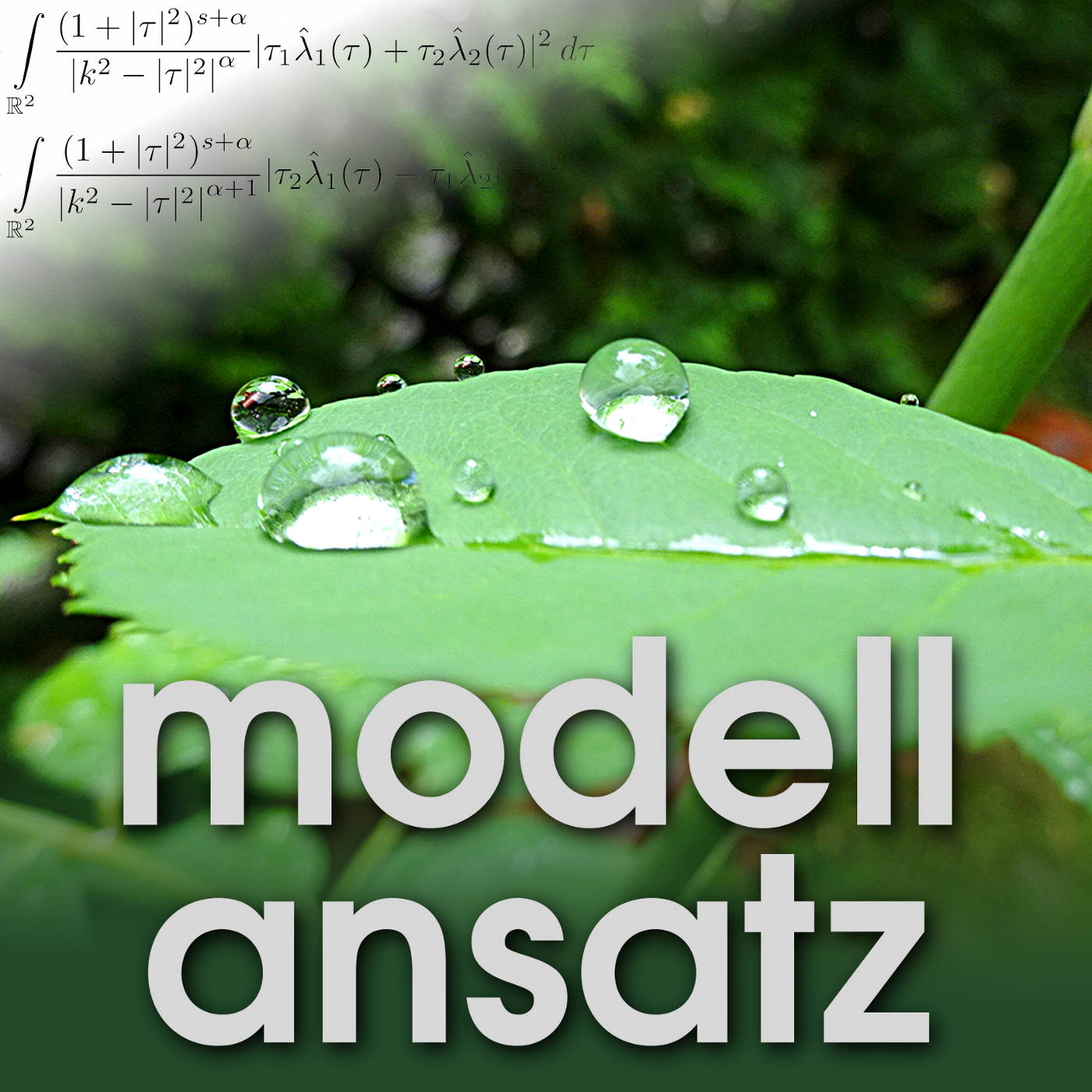
Gudrun spricht in dieser Folge mit Mathis Fricke von der TU Darmstadt \xfcber Dynamische Benetzungsph\xe4nomene. Er hat 2020 in der Gruppe Mathematical Modeling and Analysis bei Prof. Dieter Bothe promoviert. Diese Gruppe ist in der Analysis und damit in der Fakult\xe4t f\xfcr Mathematik angesiedelt, arbeitet aber stark interdisziplin\xe4r vernetzt, weil dort Probleme aus der Verfahrenstechnik modelliert und simuliert werden. Viele Anwendungen in den Ingenieurwissenschaften erfordern ein tiefes Verst\xe4ndnis der physikalischen Vorg\xe4nge in mehrphasigen Str\xf6mungen, d.h. Str\xf6mungen mit mehreren Komponenten. Eine sog. "Kontaktlinie" entsteht, wenn drei thermodynamische Phasen zusammenkommen und ein komplexes System bilden. Ein typisches Beispiel ist ein Fl\xfcssigkeitstr\xf6pfchen, das auf einer Wand sitzt (oder sich bewegt) und von der Umgebungsluft umgeben ist. Ein wichtiger physikalischer Parameter ist dabei der "Kontaktwinkel" zwischen der Gas/Fl\xfcssig-Grenzfl\xe4che und der festen Oberfl\xe4che. Ist der Kontaktwinkel klein ist die Oberfl\xe4che hydrophil (also gut benetzend), ist der Kontaktwinkel gro\xdf ist die Oberl\xe4che hydrophob (schlecht benetzend). Je nach Anwendungsfall k\xf6nnen beide Situationen in der Praxis gewollt sein. Zum Beispiel k\xf6nnen stark hydrophobe Oberfl\xe4chen einen Selbstreinigungseffekt aufweisen weil Wassertropfen von der Oberfl\xe4che abrollen und dabei Schmutzpartikel abtransportieren (siehe z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Lotoseffekt). Dynamische Benetzungsph\xe4nomene sind in Natur und Technik allgegenw\xe4rtig. Die Beine eines Wasserl\xe4ufers nutzen eine ausgekl\xfcgelte hierarchische Oberfl\xe4chenstruktur, um Superhydrophobie zu erreichen und das Insekt auf einer Wasseroberfl\xe4che leicht stehen und laufen zu lassen. Die F\xe4higkeit, dynamische Benetzungsprozesse zu verstehen und zu steuern, ist entscheidend f\xfcr eine Vielzahl industrieller und technischer Prozesse wie Bioprinting und Tintenstrahldruck oder Massentransport in Mikrofluidikger\xe4ten. Andererseits birgt das Problem der beweglichen Kontaktlinie selbst in einer stark vereinfachten Formulierung immer noch erhebliche Herausforderungen hinsichtlich der fundamentalen mathematischen Modellierung sowie der numerischen Methoden. Ein \xfcbliche Ansatz zur Beschreibung eines Mehrphasensystems auf einer makroskopischen Skala ist die Kontinuumsphysik, bei der die mikroskopische Struktur der Materie nicht explizit aufgel\xf6st wird. Andererseits finden die physikalischen Prozesse an der Kontaktlinie auf einer sehr kleinen L\xe4ngenskala statt. Man muss daher das Standardmodell der Kontinuumsphysik erweitern, um zu einer korrekten Beschreibung des Systems zu gelangen. Ein wichtiges Leitprinzip bei der mathematischen Modellierung ist dabei der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der besagt, dass die Entropie eines isolierten Systems niemals abnimmt. Dieses tiefe physikalische Prinzip hilft, zu einem geschlossenen und zuverl\xe4ssigen Modell zu kommen. (...)