Analysis und die Abschnittskontrolle
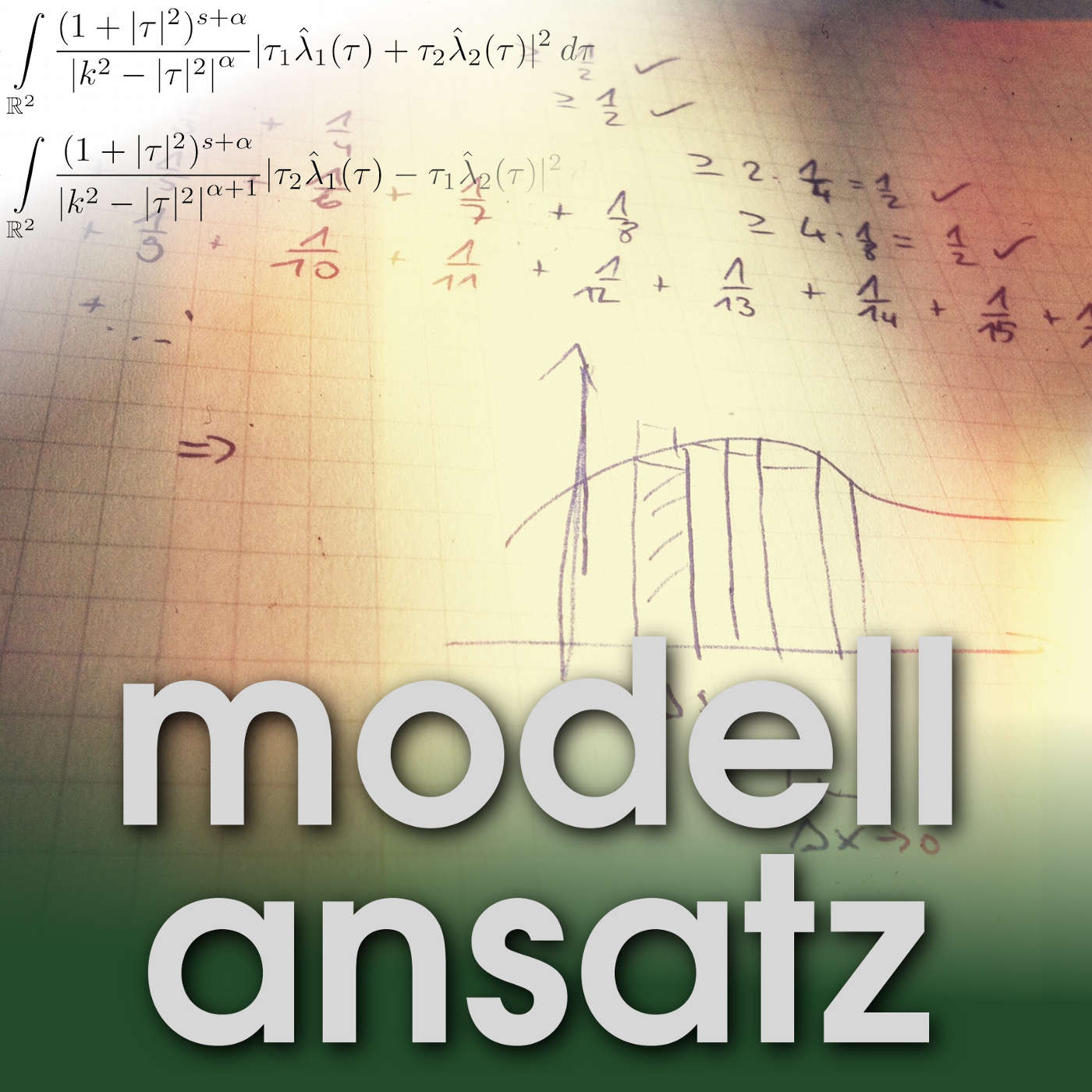
Im Herbst beginnen die neuen Studieng\xe4nge der Mathematik am KIT und neben den Vorlesungen zur Linearen Algebra, Stochastik oder Numerik geh\xf6rt die Analysis zu den mathematischen Vorlesungen, mit dem das Studium der Mathematik in den ersten Semestern beginnt. Dazu spricht Sebastian Ritterbusch mit Johannes Eilinghoff, der im letzten Jahr den \xdcbungsbetrieb der Analysis-Vorlesungen mit gro\xdfem Anklang organisiert hat. Die Analysis befasst sich besonders mit der Mathematik um Funktionen auf reellen Zahlen, welche Eigenschaften sie haben, und wie man diese differenzieren oder integrieren kann. Vieles zur Geschichte der Analysis findet man besonders in den B\xfcchern von Prof. Dr. Michael von Renteln, der unter anderem \xfcber die Geschichte der Analysis im 18. Jahrhundert von Euler bis Laplace, die Geschichte der Analysis im 19. Jahrhundert von Cauchy bis Cantor, \xfcber Aspekte zur Geschichte der Analysis im 20. Jahrhundert von Hilbert bis J. v. Neumann und \xfcber die Die Mathematiker an der Technischen Hochschule Karlsruhe 1825-1945 geschrieben hat. Grundlage f\xfcr die Mathematik in der Analysis sind die Zahlenmengen, wie die abz\xe4hlbaren nat\xfcrlichen Zahlen N, ganzen Zahlen Z, rationale Zahlen Q und schlie\xdflich die \xfcberabz\xe4hlbaren reellen Zahlen R. W\xe4hrend die nat\xfcrlichen Zahlen direkt mit dem Beweisprinzip der vollst\xe4ndigen Induktion in Verbindung stehen und f\xfcr sich schon ein Thema der Zahlentheorie sind, ben\xf6tigt man f\xfcr die Analysis mindestens die reellen Zahlen. Diese kann man \xfcber konvergente Folgen bzw. Cauchy-Folgen rationaler Zahlen einf\xfchren. F\xfcr den Beweis der \xc4quivalenz dieser beiden Konvergenzbegriffe kann man die Dreiecksungleichung sehr gut gebrauchen. Ein Beispiel f\xfcr eine Folge rationaler Zahlen, die gegen eine irrationale Zahl konvergieren ist a_n=(1+1/n)^n, die gegen die Eulersche Zahl e konvergiert, d.h. \\lim_{n\\rightarrow\\infty}a_n=e. Aus jeder Folge kann man eine Reihe bilden, indem man die Folgenglieder aufsummiert. Wichtige Reihen sind die geometrische Reihe mit Summenwert \\sum_{k=0}^\\infty q^k=\\frac1{1-q}, wenn |q|<1, und die divergente Harmonische Reihe, mit der man sogar Br\xfccken bauen kann. \xdcber den Begriff der Folge kann man auch offene Mengen und abgeschlossene Mengen definieren, so wie dies auch mit Epsilon-Umgebungen definiert werden kann. Diese Eigenschaften werden im Bereich der mathematischen Topologie noch viel umfassender eingef\xfchrt, aber schon diese Darstellungen helfen, den wichtigen Begriff der Funktion in der Analysis und deren Eigenschaften einzuf\xfchren. Zur Definition einer Funktion geh\xf6rt neben der eigentlichen Abbildungsvorschrift die Angabe der Definitionsmenge und der Wertebereich. Ohne diese Informationen ist es nicht m\xf6glich Surjektivit\xe4t und Injektivit\xe4t nachzuweisen. Eine wichtige Eigenschaft von Funktionen ist der Begriff der Stetigkeit, die man f\xfcr den Zwischenwertsatz ben\xf6tigt. Damit kann man zum Beispiel wackelnde Tische reparieren oder mit Anastasia im Science Slam Orte gleicher Temperaturen auf der Erde suchen. Der Zwischenwertsatz gilt zun\xe4chst nur f\xfcr reelle Funktionen, es gibt den Zwischenwertsatz aber auch in allgemeinerer Form. Eine weitere wichtige Eigenschaft von Funktionen ist die Differenzierbarkeit und das Berechnen von Ableitungen mit ihren Ableitungsregeln. Sehr wichtig ist dabei die Exponentialfunktion, die mit ihrer eigenen Ableitung \xfcbereinstimmt. Diese Funktion findet man im Alltag in jeder Kettenlinie in der Form des Cosinus Hyperbolicus wieder. Eine wichtige Anwendung f\xfcr differenzierbare Funktionen ist der Mittelwertsatz, ohne den die Abschnittskontrolle auf Autobahnen zur Geschwindigkeits\xfcberpr\xfcfung nicht denkbar w\xe4re. Aber auch in h\xf6heren Dimensionen kann man Differentialrechnung betreiben, und man f\xfchrt dazu den Gradienten, Richtungsableitungen und z.B. die Divergenz eines Vektorfelds ein. Als Umkehrung der Differentiation erh\xe4lt man die Integralrechnung. (...)